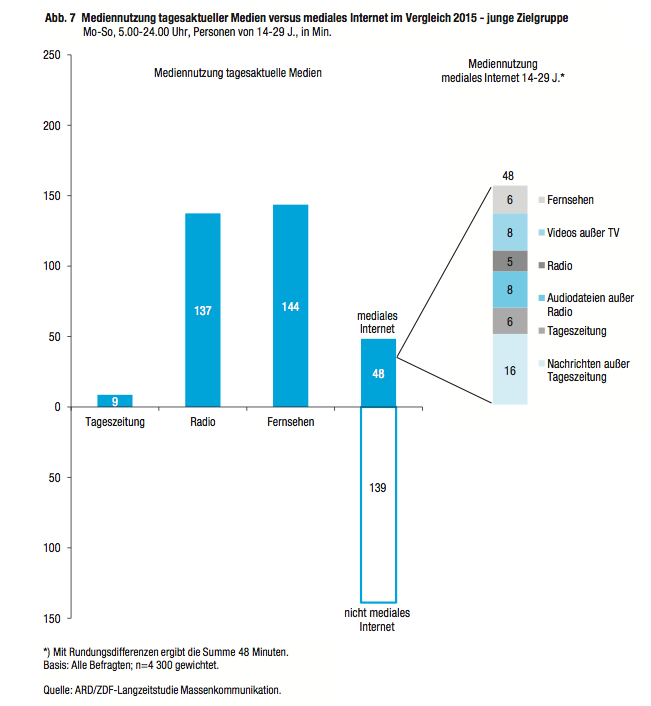Studien zur Kooperationsbereitschaft und Fairness von Menschen haben in den letzten 15 Jahren bereits mehrfach die Standard-Hypothesen verschiedener Wissenschaften in ein fragwürdiges Licht gerückt. Beispielsweise scheinen die Arbeiten von Michael Tomasello und anderen zu belegen, dass es den immer rationalen und auf seinen Eigennutz bedachten homo oeconomicus der Wirtschaftswissenschaften nicht gibt. Die Bereitschaft zu teilen und zu kooperieren erwies sich in seinen Experimenten mit Primaten und Menschen als mindestens so ausgeprägt wie egoistische Strategien.
Eine Reihe neuerer Studien unterscheidet im Hinblick auf Fairness bzw. Benachteiligung die Reaktion der Benachteiligten und derjenigen, die einen Vorteil erringen können. Die Abneigung gegen das Benachteiligtsein ist bei vielen Tierarten und auch bei Menschen weit verbreitet. Etwas anderes sagen Beobachtungen zur Abwehr oder Akzeptanz eigener Vorteile. Peter Blake, Katherine McAuliffe, Felix Warneken und andere haben untersucht, ob sich eine Abneigung gegen die eigene Begünstigung in allen Kulturen finden lässt.
Die Versuchsanordnung ermöglichte es zwei Kindern, das Angebot einer jeweils anderen Verteilung von Süßigkeiten auf beide Probanden zu akzeptieren oder abzulehnen. Das Ergebnis: Eine eigene Benachteiligung wurde in der Regel abgelehnt, und zwar überall auf der Welt. Einige ältere Kinder (es gab 900 Probanden zwischen 4 und 15 Jahren) lehnten auch eine eigene Bevorzugung ab. Diese Kinder stammten aus Kanada, den USA und Uganda – und nicht aus Mexiko, Indien, Senegal oder Peru. Gibt es in den drei genannten Ländern Ursachen für eine größere Fairness als in den anderen Ländern? Ähnliche Beobachtungen gab es schon in Studien zum WEIRD-Phänomen (Orientierung an Gleichheits-Idealen in western-educated-industrialized-rich-democratic Ländern) beim Ultimatum-Spiel, das in der Verhaltensökonomie sehr beliebt ist.
Der Psychologe Paul Bloom unternahm in einer Forschergruppe mehrere Experimente, bei denen auch wieder bestätigt wurde, dass es eine verbreitete Abneigung dagegen gibt, selbst weniger zu erhalten als andere. Dies wurde allerdings nicht vorschnell als Abneigung gegen Ungleichheit interpretiert. Statt dessen scheint ein weiterer Faktor eine große Rolle zu spielen, die Reflexion des eigenen Status.
Diese Interpretation wird dadurch unterstützt, dass altruistische Reaktionen nur dann zu beobachten sind, wenn die Partner der Versuche sichtbar sind – und ausbleiben, wenn sie es nicht sind.
Es liegt daher der Schluss nahe, dass unser Verständnis von Fairness relativistisch ist. Fairness ist ein soziales Signal und keine angeborene Eigenschaft, sie kann als Mittel zur Aushandlung der eigenen Stellung in der sozialen Hierarchie eingesetzt werden.
Viele Fragen bleiben in dieser Hinsicht noch offen. Eine schöne Darstellung liefert Maria Konnikowa im New Yorker.
<http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/how-we-learn-fairness>
„Unter der Maske des Füreinander spielt ein Gegeneinander“ – so Heidegger in Sein und Zeit.